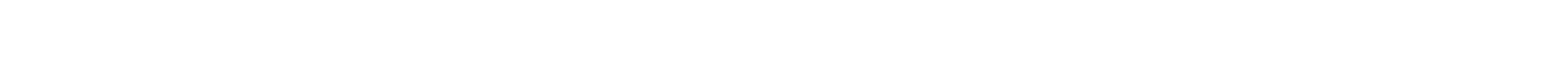Florian in Costa Rica
Florian leistete 2012/13 einen Freiwilligendienst in Longo Mai, Costa Rica. Hier einige Eindrücke von ihm...
Vor der Ausreise:
Das Telefon klingelt. Eine unbekannte Nummer. Ich nehme ab und höre eine undeutliche Stimme. „Hallo [...] bin [...] von den“. Die Bahn ist laut, wir ruckeln über eine Brücke. Ich bilde mir ein, das Wort „Kolping“ zu hören. Ich presse den Hörer ganz fest an mein Ohr. „Damit ist es offiziell – herzlichen Glückwunsch!“ Ehe ich eine Antwort geben kann, bricht die Verbindung ab. Meine Mundwinkel wandern nach oben. Ich forme eine Faust und brülle aus vor Freude. Alle Passagiere schauen mich an, ich grinse zurück. Ein toller Anfang.
In meinen ersten Blogeintrag schreibe ich: „Ich kann es immer noch kaum fassen!!! Was das eigentlich alles bedeutet, werde ich wohl erst später richtig begreifen können...“.
15, 16, 17 Scheine. Das ist viel Geld. Die Movingheads tauchen den Raum abwechselnd in grünes, rotes, blaues Licht. Der Bass, der seit einer Stunde verstummt ist, ringt noch immer in meinen Ohren. Das Benefizkonzert ist wunderschön gewesen. Unter dem Strich ist die vorgegebene Spendensumme lange nicht erreicht. Die Spendensammlerei geht fröhlich weiter.
Einen Fuß vor den anderen. Ich gehe in meinem Zimmer auf und ab. Es ist der dritte Tag nahezu ohne Schlaf. Ich gehe auf dem Zahnfleisch, breche abwechselnd in Stress und Ohnmacht aus. In zwei Stunden geht mein Flug. Ich bin gerade fertig geworden mit Packen. Endlich. Doch nicht. Langsam spüre ich, wie die positive Aufregung und die Vorfreude mich ruhig werden lassen. Ich möchte meine Heimat nicht unverrichteter Dinge hinterlassen. Ich danke allen Freunden, meiner Familie und Bekannten, die mir im Vorfeld so sehr geholfen haben, für mich da waren und allerlei mitgemacht haben. Überraschend tauchen fast alle am Flughafen auf.
Die Ankunft:
Mit einem ungesunden Kreischen federt der Jeep jeden Höhenunterschied ab. Durch den wilden Verkehr des dreckigen und stockfinsteren San Josés geht es an riesigen Schlaglöchern vorbei zu unserem Hostel. Von der Terrasse aus werfe ich einen Blick über die Hauptstadt. Neue Bilder, neue Gerüche und Geräusche. Ich reibe mir die müden Augen. In der Ferne rauscht ein Fluss. Auf den Bergen liegt Nebel. Am Himmel blitzt es geräuschlos auf.
Im Bett versuche ich mich darauf zu konzentrieren, wie es mir geht, was mich beschäftigt, worauf ich mich freue. Ich fühle nicht wirklich etwas. Da ist Vorfreude. Ansonsten ist alles wie in einem seichten Dunstschleier, der über dem Abenteuer liegt. Ab und zu flackert die Idee auf, dass es nun für ein Jahr kein Zurück gibt. Na und? Mich besticht das leise Gefühl, wir stehen vor dem Beginn von etwas Wunderbarem.
Die Matratze zittert. Ich schaue von meinem Buch auf und betrachte meinen Bettnachbarn. "Entweder er macht im Traum gerade etwas Unanständiges oder er zittert vor Angst", denke ich. Das Zittern wird stärker. Es kracht und klirrt. Noch heftiger, bis plötzlich das gesamte Bett hüpft und mit einem lauten Knall auf dem Boden aufkommt. Aus der Schrankwand neben mir schlagen die Türen auf, von der Decke sowie dem Untergeschoss kommt ein lautes Grollen und im ganzen Haus zerschellen Gläser, Vasen. Nun bin ich mir sicher, mein Bettnachbar ist nicht die Quelle der Erschütterung. In Sekundenschnelle schießen mir Gedanken in den Kopf, wie man sich im Falle eines Erdbebens verhalten soll. „Kletter unter einen Tisch, da ist es sicher“, denke ich. Es gibt keinen Tisch. Unter dem Bett ist kein Platz. Mein Nachbar wacht aus dem Tiefschlaf auf. Wir schauen uns in die Augen. Das Beben wird schwächer und schwächer. Er springt ruckartig auf, streckt die Arme in die Luft und verkündet: „Die Götter wollten, dass wir aufstehen.“
Ich mache eine Bestandsaufnahme. „Das stärkste Erdbeben Costa Ricas seit über zwanzig Jahren“, „7,5 auf der Richter-Skala“, heißt es in den Nachrichten. Kaputtes Porzellan schmückt das ganze Haus. Ich habe eine Schnittwunde von der Größe einer Hausstaubmilbe. Ein donnernder Beginn.
Grün. Mehr Grün. Immer mehr Pflanzen, Bäume, Blumen. Ich bin also tatsächlich im Regenwald! Dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt bis zum Dorfeingang von Longo Maï.
Anfangszeit im Projekt:
Hähne krähen anmutig wie vierzehnjährige Knaben im Stimmbruch bei dem Versuch, eine Arie zu schmettern. Es ist Punkt fünf Uhr. Meine Gastmutter, Doña Marta, setzt mir eine Schüssel vor die Nase, in der Reis zur Höhe des Himalayas aufgetürmt ist, garniert mit allen Bohnen, die man im Dorf auftreiben konnte. Dazu gibt es Platanos (gebratene Kochbananen) und ein Stück Käse, der aussieht wie ein Schwamm und beim kauen quietscht. Den Kaffee, der gerade noch durch eine Socke getropft ist, schütte ich hinterher.
Schwer und ungewohnt liegt die Machete in meiner Hand. Die Pflanzen, die Bäume, die klackernden Vogelgeräusche, das Zirpen der Grillen, der reißende Fluss, den man bereits aus kilometerweiter Entfernung rauschen hört, das alles kenne ich bis dahin nur aus dem Bilderbuch oder Fernsehreportagen.
Ich stehe da auf einer weiten, grünen Weide und schaue auf den Regenwald. Den Bambus und die Palmen vor mir, ringsum im Hintergrund die Berge, deren Spitze die Sonne in farbige Punkte taucht. Ich fühle mich trunken. Es geht hinein. Immer weiter, durch dichtes Gestrüpp, über Blätter und kleine Bäche, die aus den Felsen quellen. Plötzlich ist das Passieren nur möglich, wenn wir uns mit der Machete einen Weg bahnen. "Genau wie im Film!" denke ich die ganze Zeit.
Eine Lichtung eröffnet sich vor mir. Die Einarbeitung geht schnell, und es macht mir zunehmend mehr Spaß, den Bambus zu fällen und zurechtzuschneiden. Die Arbeit ist anstrengend im tropischen Klima. Zuhause warten zur Mittagszeit Reis und Bohnen zur Stärkung. Zur Abkühlung springe ich mit meinen Arbeitskollegen in den erfrischend kühlen Fluss. Ich nehme einen tiefen Schluck. Eine willkommene Abwechslung zum gechlorten Trinkwasser in den Häusern.
Alle Leute empfangen mich herzlich und scherzen viel. Jeden Tag erlebe ich so viel aufregendes Neues, lerne so viele interessante Menschen kennen, dass ich kaum hinterherkomme, alles festzuhalten. Ich labe mich förmlich an den frischen Früchten. Hunderte bekannte und noch einmal zehnfach so viele unbekannte, die geschmacklich auf der Zunge explodieren. All das Schöne überwiegt. Für eiskalte Duschen, Unpünktlichkeit und die vielen Moskitos werde ich reichlich entschädigt.
Mitten im Freiwilligendienst:
Dieser ganz spezielle Moment: Wenn du in Gummistiefeln einen steinigen Pfad hochsteigst, hinter dir nähert sich klackernd eine Staubwolke, du pfeifst, das Auto bleibt stehen. Du springst gekonnt auf, schiebst Macheten sowie Kaffeesäcke zur Seite und lehnst dich an den Rand der Ladefläche. Das Auto fährt los. Du hältst dich fest, dein Gesäß freut sich über all die prächtigen Schlaglöcher; während dir bei Tempo 60 bergab der Wind die Haare zerzaust, schaust du auf leuchtend grüne Landschaften, Viehherden, Palmen, nebelumspielte Berge und in einen strahlend blauen Himmel. Und du denkst dir, nichts Besonderes. Genau! „Schön hier“, vielleicht, aber nichts weiter – zu sehr hast du dich bereits an diese unglaubliche Naturpracht, diesen anderen Lebensstil, an ein „pura vida!“ gewöhnt. Ein neues Gefühl, ungewohnt, aber irgendwie erhebend. Auch mit der Sprache läuft es mittlerweile fließend, ich erkenne einen Sternfruchtbaum an der Blattform, überhaupt weiß ich, dass „Carambolas“ am Baum wachsen, bin im Tagesablauf der Ticos angekommen, selbstverständlich benutze ich meine Machete als Werkzeug, gehe in den Regenwald oder betrachte gelangweilt abwechselnd die handtellergroße Küchenschabe, dann die faustgroße Vogelspinne im Bad.
Schwere Tropfen prasseln seit Stunden gegen die Scheiben. In einer Stunde treffen sich die anderen Freiwilligen, um zu feiern. Ist mir egal, ich werde nicht hingehen. Mir geht es bescheiden. Ich vermisse meine Freunde, die mich normalerweise auffangen, wenn ich schlechte Laune habe. Der Regen wird heftiger. Nichts wünsche ich mir gerade sehnlicher als meine Ruhe. Im Nebenraum spielen, schreien, weinen fünf kleine Enkel meiner Gastmama. Wenigstens verursacht das aufs Dach aufpeitschende Wasser einen solchen Geräuschpegel, dass man den bis zum Anschlag aufgedrehten Fernseher, in dem ein Kindercartoon mit hohen, quietschigen Stimmen läuft, nicht hören kann. Ich öffne den Buchdeckel meines Romans und klappe ihn wieder zu. Ich ziehe meine Decke bis über die Nase. Es regnet und regnet und regnet.
Ein Schweißtropfen rinnt mir über die Stirn. Die Sonne brennt ohne Gnade von oben. Ich muss mich beeilen, denn in wenigen Minuten steht eine Reunion auf der Agenda. Meine Englischschüler haben heute lange gebraucht, um ihre Aufgaben zu erledigen. Kaum schaue ich auf die Uhr, ist wieder eine halbe Stunde rum. Meinen Deutschunterricht muss ich auch noch vorbereiten. Hoffentlich dauert das Treffen mit dem Projektpartner nicht zu lange, denn ich habe auch noch nichts gegessen, und am Abend wollten wir uns schon wieder mit der Jugendgruppe austauschen. Heute Abend werde ich sehr früh schlafen gehen, immerhin geht es morgen um halb fünf schon aufs Zuckerrohrfeld.
Es ist heiß, es ist schwül, es ist Heiligabend. Die Stimmung ist gut, aber nicht festlich. Wohin ich auch schaue, wohin ich auch gehe, treffe ich auf Familienmitglieder. „Wo schlafen die eigentlich alle?“, frage ich mich. Überall wird exzessiv getanzt. Über die Weihnachtstage habe ich noch nie so viel abgenommen wie dieses Jahr. Eigentlich habe ich überhaupt noch nie an Weihnachten abgenommen. Auch das Essen ist nicht außergewöhnlich für Costa Rica. Es gibt Tamales und auch einmal hier und da Süßigkeiten, aber mit der Weihnachts- und Zuckerbäckerei in Deutschland ist das alles nicht zu vergleichen; Geschenke werden sich bei Gelegenheit eben zwischendurch oder bereits im Voraus in die Hand gedrückt. Mir fehlen die Feierlichkeit, der Pomp, das Drama, der Glanz und der Stress, den die Deutschen alljährlich veranstalten aufrichtig. Dafür backe ich Weihnachtsplätzchen, verfeinert mit Coco, Guanabana und Guave. Sie stehen für mich als perfekte Symbiose zwischen Deutschland und Costa Rica. Dass sich beides mittlerweile prima miteinander verbinden lässt, zeigt mir: Nun bin ich wirklich angekommen.
Am Ende des Dienstes – ein Fazit:
Zurück aus dem Urlaub lasse ich meine ganzen Eindrücke sacken. Besonders spannend finde ich, wie sehr Costa Rica sich von allen anderen Zentral- sowie Südamerikanischen Ländern unterscheidet. Für meine Familie ist es seltsam, dass ich das Wort Urlaub überhaupt in den Mund nehme. So unglaublich das klingen mag, aber auch die Arbeit mitten in einem landschaftlichen Paradies ist letztendlich Arbeit. Und ich habe unermüdlich gearbeitet in meinem Freiwilligendienst, viel geschafft und auch einige harte Zeiten durchgemacht.
Verschlafen kraxel ich aus dem Bett. Als ich mir meine Hose anziehen möchte, muss ich erst den Skorpion rausschütteln. Über zwei Hunde steige ich zu meiner Zahnbürste. Ich betrachte die Truthähne, die auftrudeln. Den Plausch am Morgen mit ihnen werde ich vermissen. Die dummen Hühner, die immer stundenlang aufgackern, nachdem sie ein Ei gelegt haben und überall hinmachen, weniger. Auch wenn es etwas für sich hat, jeden Tag frisches Spiegelei auf seinem Gallo Pinto zu haben. Meiner Gastmutter erkläre ich auf ihrem Gang, die Ziegen zur Weide zu führen, meine Tagespläne. Dabei frage ich mich, wieviel Spanisch ich wohl verlernen werde, zurück in Deutschland.
Die Ausreise steht unmittelbar bevor. Wie es sich für einen guten Abschied gehört, verlasse ich Land, Projekt und Menschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es gibt vieles, auf das ich mich zu Hause freue, vieles, was ich vermisst habe. Auf der anderen Seite habe ich mich unsterblich in Costa Rica verliebt – mit all seinen Stärken und Schwächen. Meine Gastfamilie wird mir am meisten fehlen, ebenso wie die teils noch unberührte, überwältigend schöne Natur. Dann wieder habe ich meine Projekte nachhaltig abgeschlossen und kann zufrieden sein mit meiner Arbeit. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, zu gehen. Den möchte ich nicht verpassen und daher feiere und genieße ich meine letzten Tage im Dorf mit jedem Atemzug. In der Heimat warten Familie, Freunde und ein neuer Lebensabschnitt, denen ich mit Spannung entgegenfiebere. Nach Costa Rica werde ich eines Tages zurückkehren, es gibt also keinen Anlass zur Trauer! Ich bin von Herzen dankbar für die Chance, die weltwärts und Kolping mir geschenkt haben sowie froh und glücklich, die Entscheidung getroffen zu haben, einen Freiwilligendienst in Costa Rica zu machen.